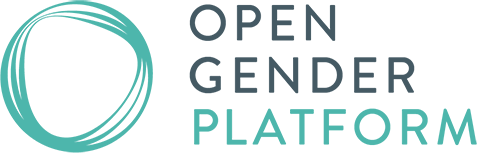In vielen Ländern, darunter Deutschland, wird die psychiatrische Diagnose der ›Geschlechtsidentitätsstörung‹ (DSM IV, ICD 10), oder ›Gender Dysphoria‹ (DSM V) vorausgesetzt, um trans*spezifische Gesundheitsversorgung und eine legale Anerkennung von Namen und Geschlechtsidentität zu erhalten. Die gesellschaftliche Marginalisierung von trans*-Personen ist umso wirkmächtiger, wenn Personen durch mehrere Diskriminierungs- und Herrschaftsverhältnisse konstituiert werden. Trans* Menschen sind aufgrund cisnormativen gesellschaftlichen Strukturen darauf angewiesen, eigene Strategien zu entwickeln, mit Diskriminierungserfahrungen umzugehen. Im Zentrum meinem queer-feministischen ethnographischen Dissertationsprojekt stehen informelle Community Care Praktiken von trans* und nicht-binären Aktivist*innen in Deutschland und der deutschsprachigen Schweiz. Diese bewegen sich zwischen informeller emotionaler Arbeit, Selbsthilfe-Praktiken, Peer-Begleitungen zu Gutachter*innen- und Operations-Terminen und Trans-Aktivismus-Burnout-Prävention. Methodologisch verorte ich mein Dissertationsprojekt in der Tradition queer-feministischer engagierter ethnographischer Ansätze. Ein besonderen Fokus lege ich hierbei auf die Auseinandersetzungen mit Möglichkeiten und Herausforderungen von „insider ethnographies“ und der Infragstellung von Dichotomien aber auch Machtdynamiken in der eigenen Wissenproduktion. Ich werte mein „Material“ mit dem Ansatz der Reflexiven Grounded Theory aus (Breuer 2009). Die theoretischen Hintergrundfolien zur Interpretation des empirischen Materials bilden theoretische Auseinandersetzungen aus Queer- und Trans Studies, Queer Anthropology, sowie Debatten um Care und Intersektionalität.
Neuste Beiträge
- [CfC] Tagung: Demokratisierung der Sinne
- [Veranstaltung] „Care and (un)fair?“ Podiumsdiskussion und Präsentation
- [Veranstaltung] ZtG-Kolloquium: Geschlecht – Körper – Vielfalt (7./8.11.2024)
- [Veranstaltung] Tagung „Diversität als hochschulpolitische Herausforderung“ (29.11.2024)
- [CfC] Tagung „Demokratisierung der Sinne —Sinnlichkeit der Demokratie. Emanzipation als Erfahrungen von Gleichheit in hierarchisch anders sensorischen Räume”
 Open Gender Journal
Open Gender Journal
- Doing Family unter erschwerten Bedingungen Anna Buschmeyer
- Institutionelle Reaktionen auf geschlechtsspezifische Gewalt in der Wissenschaft im nordischen Kontext als Formen der Fürsorge überdenken Angelica Simonsson
- Von rassistischen Weiblichkeits- und Männlichkeitskonstruktionen. Rassismuserfahrungen und Coping Strategien asiatisch gelesener Menschen Ines Hiegemann
Schlagwörter
Hinweis
Die Fachgesellschaft veröffentlicht auf ihrer Website auch Hinweise der Arbeitsgruppen und der Initiativen innerhalb der FG. Deshalb spiegeln die Hinweise nicht notwendigerweise Positionen oder Ziele der Fachgesellschaft wider.