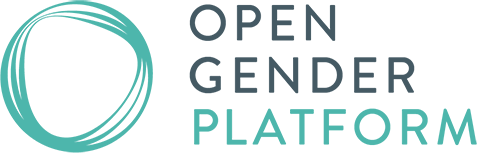Eröffnung der gemeinsamen Konferenz der D-A-CH Fachgesellschaften für Geschlechterforschung/-studien vom 28.-30.09.2017 in Köln Susanne Völker, 1. Sprecherin der Fachgesellschaft Geschlechterstudien (D)
1. Unbegrenzbare Herausforderungen
Wir erleben gegenwärtig Zeiten, in denen globale Probleme und Ungerechtigkeiten keineswegs abgebaut werden, sondern sich noch zuspitzen wie der milliardenfache Ausschluss von Menschen von grundlegenden Ressourcen und Infrastrukturen zeigt: Hunger bleibt ein Problem – vor allem im globalen Süden; Kriege bestimmen und zerstören das Leben vieler, ungenannt bleibender Individuen, Menschen, die vor Gefahren, Gewalt, Verfolgung und Mangel fliehen, werden durch die verschiedenen Abschottungspolitiken europäischer Länder Not und Tod ausgesetzt. Weltweit – in unterschiedlichen Ausmaßen – haben wir es mit der Verweigerung, dem Verlust und Abbau von demokratischen Rechten zu tun, häufig motiviert durch Rassismus und kulturelle, religiöse und soziale Differenzsetzungen, durch Sexismus, durch Diskriminierung aller, die dem Raster der Zweigeschlechtlichkeit, den Gesetzen heteronormativen Begehrens nicht entsprechen… – wollen.
Wir erleben und sind Teil von Herausforderungen, die aber nicht nur das Zusammenleben von Menschen betreffen, sondern ebenso das von Menschlichem und Nichtmenschlichem. Sogenannte ‚Naturkatastrophen‘, Prozesse wie Erd- und Meereserwärmung, aber auch die Aktivität der Erdplatten, die zu jenen verheerenden Erdbeben in Mexiko geführt haben, bringen menschlichen Alltag hervor, zerstören ihn mitunter, allerdings unter höchst unterschiedlichen Bedingungen: Wer Möglichkeiten des Schutzes und der Sicherheit hat, differiert nicht nur nach geographischem Standort, sondern auch nach geopolitischen und geosozialen Ungleichheiten und Hierarchisierungen. In den derzeitigen Debatten um ein sogenanntes Anthropozän steht ein menschliches ‚Wir’ auf dem Spiel, ein ‚Wir’, das, wenn ich die feministische Kritik an diesem Begriff des Anthropozän richtig verstehe, nur überleben wird, wenn es sich nicht exklusiv und exzeptionell versteht, sondern als abhängig und verletzbar.
Sie werden vielleicht und nicht ganz zu Unrecht denken: Ein zu großer, überladener und damit auch kurz geschlossener Bogen, den ich hier für die Frage der Geschlechterforschung und ihre Herausforderungen spanne!
Und dennoch geht es mir darum zumindest anzudeuten, was auch ‚mitschwingt‘, wenn ‚wir‘ – unterschiedlich positionierte Geschlechterforscher_innen – ‚uns’ hier versammeln. Unsere Fragen, unsere Perspektiven, unsere Praktiken sind verflochten, sind Teil einer nicht aufhebbaren Komplexität von Welt, unsere Fragen sind verbunden mit anderen Fragen, anderen Phänomenen, die wir vielleicht zunächst einmal nicht meinen und nicht anzielen, die aber wirksam sind. Und auch wenn es gilt, in Forschung und wissenschaftlicher Praxis konkretisierte Fragestellungen, historistisch-spezifische Problematisierungen zu formulieren, wenn ‚wir’ unsere Gegenstände konstruieren, unsere Messinstrumente wählen und unsere Apparate begrenzen – ‚agentielle Schnitte’ vornehmen, wie es die us-amerikanische Wissenschaftsforscherin Karen Barad nennt – so bleibt es doch dabei:
- Die Komplexität, die Unverfügbarkeit von Welt ist nicht auszuschließen, stillzustellen und zu
- Wie Forschende, Fragende, Wissen-Mithervorbringende diese Komplexität in ihren Aufstellungen berücksichtigen, ist von Belang, gerade, wenn es um Begrenzungen des Gegenstandes und um die Partikularität des Spezifischen
- Wissenschaft als wirklichkeitsschaffende Praxis zu begreifen, auch und gerade wenn über diese ‚Wirklichkeit’ nicht verfügt werden kann, bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für das, was untersucht, was artikuliert, was sichtbar gemacht, kurz: was gemacht
All das ist sicher nicht nur Sache der Geschlechterforschung. Es hängt aber zusammen mit der Kritik eines Wissenschaftsverständnisses, in dem Wissenschaft als ortloses, eben objektives Geschehen, ihre eigene – auch geschlechtliche – Situiertheit unsichtbar macht: der God-trick, wie Donna Haraway sagt, ein Sprechen von nirgendwoher, das Haraway (1996: 352) als „spezifisch moderne, europäische, maskuline, wissenschaftliche Form“ bezeichnet hat. Keineswegs sind Geschlechterforschungen vor dem ‚God-Trick’ der Universalität und des (Selbst)Unsichtbarmachens gefeit, aber zur Geschichte der unterschiedlichen Strömungen der Gender Studies und Queer Theory gehört – nicht als Selbstläufer, sondern als Ergebnis streitbarer Interventionen – gerade die Kritik einer solchen Naturalisierung hegemonialer Praktiken, seien sie andro-, anthropo- oder eurozentrisch oder auch heteronormativ.
2. Differente Sichtbarkeiten
Es gibt aber auch eine andere Unsichtbarkeit: die Unsichtbarkeit dessen, was im göttlichen Blick des ‚ortlosen Wissenschaftlers’ nicht erscheinen kann, die Unsichtbarkeit dessen, was nicht ein für alle Mal gegeben, klassifizier- und lokalisierbar ist. Andere Sichtbarkeiten zu erzeugen, andere Möglichkeiten des sich Artikulierens, des Wahrnehmbar- und Denkbarwerdens, sind ebenso zentrale Fragen der Geschlechterforschung und der Queer Theory.
Gesehen, als menschliches Leben erkannt und wahrgenommen zu werden, ist – darauf hat Judith Butler vielfach hingewiesen – Voraussetzung dafür, jene Rechte in Anspruch nehmen und einklagen zu können, die gemeinhin einem spezifisch menschlichen, männlichen, europäischen, weißen, heterosexuellen Subjekt vorbehalten bleiben.
Die Wahrnehmung zu verweigern, die Grenzen der Intelligibliität abzustecken, heißt: Relationalität zu unterbinden und Empfänglichkeit gegenüber Anderen/m machtvoll zu verhindern. In dieser Weise ‚Nicht gesehen zu werden’, ‚Nicht erscheinen zu können’ heißt, auf soziale Unorte verwiesen zu sein, heißt einer Prekarität ausgesetzt zu sein, die Politiken des Entzugs von Lebensgrundlagen und der Gefährdung stützt.
Das Ringen um das Erscheinen-können in aller Öffentlichkeit von Menschen, deren Leben durch machtvolle Differenzsetzungen in marginalisierte und subalterne Bereiche abgedrängt werden, das Auftreten von LGBTTIQ-Personen, von People von Colour, von Dis/abled Persons, das Artikulieren von unterschiedlichen Ansprüchen, Realitäten, Selbstverhältnissen, stellte und stellt fortdauernd wissenschaftliche Praktiken – auch der Geschlechterforschung – in Frage, dezentriert und ‚provinzialisiert’ Wissenspraktiken – wie man in Anlehnung an Dipesh Chakrabarty sagen könnte.
Auf welche Weisen welche Differenzen erscheinen können, ist von Belang. Und im Sinne der Vielfältigkeit einer geteilten Welt, des fortwährenden Ringens um das Erscheinen kontingenter Differenzen, um die Frage des Wie der Differenzsetzung und des Ermöglichens von Unbestimmtheit, ist es nicht banal und nicht überflüssig, auf Komplexität, Kompliziertheit und Unverfügbarkeit zu bestehen – auch in der Debatte um konkrete Herausforderungen.
„Was passiert, wenn menschlicher Exzeptionalismus und beschränkter Individualismus, diese vertrauten Spielwiesen westlicher Philosophie und politischer Ökonomie, in den besten Wissenschaften – egal ob Natur- oder Sozialwissenschaften – undenkbar werden?“, schreibt Donna Haraway in Staying with the Trouble und sie fährt fort: „Es macht einen Unterschied, welche Gedanken Gedanken denken. Es macht einen Unterschied, welche Wissensformen Wissen wissen. Es macht einen Unterschied, welche Beziehungen Beziehungen schaffen. Es macht einen Unterschied, welche Welten Welten hervorbringen. Es macht einen Unterschied, welche Geschichten Geschichten erzählen.“ (Haraway 2017: 214)
3. Eigenes, Eindeutiges und Mehrheitliches
Die Geschichten, mit denen sich auch Geschlechterforscher_innen in der bundesdeutschen Öffentlichkeit konfrontiert sehen, beinhalten sehr spezifische Differenzsetzungen: Die wichtige, was den Erfolg der mindestens rechtsnationalen Partei Alternative für Deutschland (AfD) bei der Wahl zum deutschen Bundestag betrifft, vielleicht zentrale Differenzlinie, ist die Differenz zwischen ‚Eigenem’ und ‚Fremdem’, zwischen ‚Mehrheiten’, die nicht mehr zu ihrem Recht kommen, und ‚Minderheiten’, die demokratisch vermeintlich überbewertet, ‚überberücksichtigt’ durch eine ‚überzogene’ political correctness und entsprechend ‚überversorgt’ werden. Eigenes, Eindeutiges und Mehrheitliches – das sind zentrale Differenzkategorien aktueller politischer Mobilisierung.
Wobei die Lust daran, doch nun endlich offen, ohne Scham die eigenen Bedarfe zum alleinigen Maßstab zu machen, das Begehren nach Klarheit, Bestimmtheit und Eindeutigkeit – auch Eindeutigkeit im Partei-nehmen-für-sich-selbst – sehr viel breiter ist als der politische Raum rechts der CDU.
Die Angriffe, das Misstrauen und die Wut richtet sich auch auf ‚die’ Wissenschaft und einen Journalismus, der für Bildungseliten, für Expert_innenwissen und für den Bezug auf ‚Fakten’ steht.
Den Motiven für Abschottung, dem Beharren auf dem Eigenen, dem Bestehen auf Männlicher Herrschaft (Bourdieu) als Doxa ist nicht allein durch bessere Aufklärung, durch genauere Zahlen beizukommen – es geht hier nicht um ein ‚Informationsdefizit’. Es geht um konditionierte Wahrnehmungen, um die Rasterung von Affekten und die Begrenzung von Empfänglichkeit und Ansprechbarkeit. – Und darum, wie Wissenschaft, wie Geschlechterforschung auf diese Herausforderungen der Gegenwart, auf diese diskriminierenden, verletzenden Differenzsetzungen antwortet.
Dabei geht es vielleicht weniger um eine Entscheidung, worauf das wissenschaftliche Augenmerk gelegt wird: auf jene, deren Verwundbarkeiten, deren Gefährdungen für belanglos erklärt werden, oder jene, deren Verkennungen sich menschenverachtend, antidemokratisch artikulieren. Es könnte ja auch sein, dass es einen Zusammenhang zwischen Verletzung und dem verhängnisvollen, ja tödlichen Begehren nach Unverletzbarkeit gibt. Wissenschaft antwortet auf diese grundlegende Frage nach der Verletzbarkeit und es kommt darauf an, wie sie das tut, mit welchen Forschungsstrategien, welchen Praktiken des Wissens, welchen Anordnungen.
Es geht also um die Frage, was erscheinen kann: die kritische Frage der Intelligibilität und der Erweiterung des Möglichen in machtvollen Räumen.
Es geht aber auch darum, herauszuarbeiten, zu rekonstruieren, worauf – auch diskriminierende, verletzende – Differenzen antworten. Und zwar nicht, um sie zu legitimieren, zu verharmlosen, sondern auch hier: um Anderes möglich zu machen. Um in der Tat zu verstehen, auf was warum so ‚falsch’, so gewalthaft geantwortet wird und welche Diskurse, welche sozialen Differenzen, welche Perspektivierungen verhindern, dass von den Differenzsetzungen des ‚Eigenen’ und des ‚Fremden’, des ‚Wir’ und der ‚Anderen’, des ‚Normalen’ und der ‚Devianz’/ des ‚Perversen’ abgelassen werden kann.
4. Köln – Chiffre und Raum oder: „Es macht einen Unterschied, welche Geschichten Geschichten erzählen“
Unsere Tagung findet in Köln statt. Seit der Silvesternacht 2015 verbindet sich mit Köln eine Verdichtung von Konflikten, die auf spezifische Weise kulturalisiert, ethnisiert, rassisiert werden, die Gruppen von Schutzbedürftigen und Beschützenswerten auf der einen Seite, von Bedrohlichen auf der anderen Seite schafft und beschützende, ordnende Kräfte anruft. Was auf und vor dem Kölner Hauptbahnhof in Form von zahlreichen sexualisierten Übergriffen auf Frauen geschehen ist, kann hier in konkreten Vorgängen nicht benannt oder gar aufgeklärt werden – das wäre vermessen, es ist ein notwendiges und vermutlich zugleich ein unmögliches Unterfangen. „’Köln’“– wie Sabine Hark und Paula-Irene Villa (2017) In ihrem unlängst erschienenen Essay „Unterscheiden und Herrschen“ präzise analysieren – „(ist) aber auch der Name eines notorisch unklaren Ereignisses, eine durch Zeit und Raum zirkulierende Chiffre, die eine Vielzahl von Bedeutungsspuren umfasst und beständig Bedeutungsresonanzen erzeugt“– „leer und aufgeladen zugleich“ (ebd.: 9)
Deshalb müssen ‚wir’ – ein kompliziertes ‚wir’ heterogener Verbündeter – auch weiter auf dieses Ereignis antworten, anders antworten, auf die Verletzbarkeit bestehen, mit der dieses Ereignis aufgeladen ist: auf die Verletzbarkeit deren, die Übergriffe erfahren haben, und auf die Verletzbarkeit derer, die (nicht erst) seitdem stereotypisiert und verächtlich gemacht werden.
Es gibt auf dieses Ereignis und auf die Gewalt, die es ermöglicht und die es produziert hat, keine Antwort in den Dichotomien eines ‚wir und die Anderen’, modern und traditionell, emanzipatorisch und rückschrittlich, frei und unterworfen. Dass davon dennoch auch vermeintlich feministische Debatten nicht unberührt bleiben, davon zeugen die islamfeindlichen, die „kulturessentialistischen“ Auslassungen von Alice Schwarzer und einigen Emma-Autor_innen – nicht nur Judith Butler und Sabine Hark haben darauf überzeugend geantwortet.
Aber ‚Köln’ ist ohne Zweifel mehr – ein Ort, von dem aus bereits in den 1970er Jahren mit den Arbeiten von Maria Mies streitbare methodologische und theoretische Impulse in die damalige Frauenforschung eingingen; ein Ort, an dem 1976 das zweite bundesdeutsche Frauenhaus erkämpft wurde. Köln ist die Stadt mit einer seit Jahrzehnten lebhaften Queer Szene, der Kölner CSD wird seit 1991 von einer vielfältigen Gay und Lesbian Community veranstaltet. Köln als Stadt und als Hochschulraum beherbergt Menschen unterschiedlicher Herkünfte und Positionierungen. Und – um das auch noch einmal in eigener Sache hinzuzufügen – endlich und längst überfällig startet im Wintersemester der gemeinsame Master Studiengang Gender & Queer Studies der Universität zu Köln und der Technischen Hochschule Köln in Kooperation mit der Hochschule für Musik und Tanz Köln.
Köln ist also ein ambivalenter und in diesem Sinne nicht verortbarer Ort, ein Ort, an dem zentrale Herausforderungen der Geschlechterforschung sich artikulieren, an dem sie von Geschlechterforscher_innen verhandelt werden in einer Stadt, in der soziale, kulturelle, sexuelle und religiöse Vielfalt – eben auch jenseits essentialisierender Vereindeutigungen – gelebt wird – wie in jeder Stadt, möchte ich hinzufügen. Mit all dem ist Köln, so meine ich, jedenfalls ein sehr passender Ort für unsere Konferenz und unsere Konferenz eine sehr passende Antwort auf das, was unter dem Namen Köln zirkuliert. Was aus dieser Verbindung entsteht, ist – so hoffe ich – ein Möglichkeitsraum, um Komplexitäten, Differenzen und Differenzierungen, Unbestimmtheiten und Uneindeutigkeiten, um Allianzen zu verhandeln und zu praktizieren – mit einem wissenschaftlichen Engagement, dem es gelingt, die „affektiven Bande über die Grenzen von Ähnlichkeit und Gemeinschaft hinaus auszuweiten“, wie Judith Butler formuliert hat (Butler / Athanasiou 2014: 254).
Vielen Dank!
Literatur
Butler, Judith/Athanasiou, Athena (2014): Die Macht der Enteigneten, Zürich-Berlin. Haraway, Donna (1996): Anspruchsloser Zeuge@ Zweites Jahrtausend. FrauMann© trifft Onco Mouse TM, in: Scheich, Elvira (Hg.): Vermittelte Weiblichkeit. Feministische Wisenschafts- und Gesellschaftstheorie, Hamburg, 337-389. Haraway, Donna (2017): Tentakulär Denken. Anthropozän, Kapitalozän, Chthuluzän. In: Karin Harrasser (Hg.): Auf Tuchfühlung. Eine Wissensgeschichte des Tastsinns. Frankfurt / M, 209-237. Hark, Sabine, Villa, Paula-Irene (2017): Unterscheiden und Herrschen. Ein Essay zu den ambivalenten Verflechtungen von Rassismus, Sexismus und Feminismus in der Gegenwart. Bielefeld.